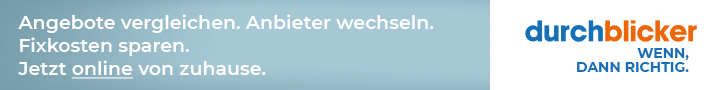Wann ist Grunderwerbsteuer zu bezahlen?
Seit 2016 gelten neue Regelungen in Sachen Grunderwerbsteuer in Österreich. Mit Erwerb von Grundstück und Immobilie – ob Schenkung, Kauf oder Erbschaft – ist die Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Beim Kauf beträgt diese 3,5 % des Kaufpreises. Bei Schenkung und Erbschaft gilt der Grundstückswert als Bemessungsgrundlage – hier kommt ein Stufentarif zum Einsatz.
Inhaltsverzeichnis
| Grunderwerbssteuer seit 2016 |
| Wann ist sie zu zahlen? |
| Höhe und Berechnung |
| Fälligkeit |
| Sonderregeln (Verwandte, Landwirtschaft, teilentgeltl. Erwerb) |
| Befreiung |
| Absetzbarkeit |
| Fazit |
| Video (Grundlagen) |
| FAQ |
Neue Grunderwerbsteuer in Österreich seit 2016
Die Vorschriften zur Grunderwerbsteuer in Österreich haben sich im Zuge der Steuerreform 2016 geändert. Bis dorthin war vor allem die Besteuerung von Schenkungen, Erbschaften und Verkäufen im Familienkreis anders geregelt: Als Bemessungsgrundlage galt bis dahin der dreifache Einheitswert, anstatt des jetzt herangezogenen Grundstückswertes. Da der dreifache Einheitswert in Praxis meist deutlich unter dem Grundstückswert liegt, haben sich Erbschaften bzw. Schenkungen im Zuge der neuen Grunderwerbsteuer meist deutlich verteuert.
Weiters betrafen die Änderungen betrafen die Änderungen insbesondere die Definition des Familienkreises. Dieser wurde deutlich erweitert, sodass beispielsweise nun auch Geschwister, Nichten, Neffen und Verschwägerte hinzugerechnet werden. Was aktuell in Sachen Grunderwerbsteuer gilt und wie sich diese berechnet, das erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Grunderwerbsteuer – wann ist sie aktuell zu zahlen?
Prinzipiell fällt die Grunderwerbsteuer bei jedem entgeltlichen oder unentgeltlichen Erwerb eines Grundstücks in Österreich an. Als Erwerb zählen beispielsweise:
- Kauf
- Erbschaft
- Schenkung
- Tausch
- Eigentumsübergabe bei Scheidung
Zum Grundstück zählen Grund und Boden, das darauf befindliche Gebäude sowie Inventar, Pflanzen oder Tiere. Somit müssen Sie nicht nur beim Kauf eines Hauses oder Grundstücks Grunderwerbsteuer zahlen – gleiches gilt beispielsweise auch beim Erwerb einer Eigentumswohnung.
Grunderwerbsteuer – Höhe und Berechnung
Wie hoch fällt die Grunderwerbsteuer aus? Das ergibt sich aus zwei Faktoren:
- Bemessungsgrundlage: Wert, den das Finanzamt dem Grundstück zuschreibt, um die Steuer zu berechnen.
- Steuersatz: Prozentsatz von der Bemessungsgrundlage, der als Steuer zu bezahlen ist.
Die konkrete Berechnung der Steuerschuld folgt hierbei einer einfachen Formel:
Steuerschuld = Bemessungsgrundlage x (Steuersatz / 100)
Prinzipiell müssen Sie in Österreich 3,5 % an Grunderwerbsteuer zahlen: Je nachdem, ob Ihr Erwerb entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt, gibt es aber spezielle Regelungen:
Die Grunderwerbsteuer beim Kauf (3,5 %)
Grundstückskäufe gelten als entgeltlicher Erwerb. Sie haben also die volle Grunderwerbsteuer von 3,5 % des Kaufpreises zu zahlen. Dies bedeutet konkret:
- Bemessungsgrundlage: in der Regel der Kaufpreis oder nicht-finanzielle Leistungen (Tausch)
- Steuersatz: 3,5 %
Beispielfall: Familie F. kauft ein Einfamilienhaus zum Preis von 720.000 Euro. Bei vollem Steuersatz muss die Familie 720.000 Euro x 0,035 = 25.200 Euro an Grunderwerbsteuer ans Finanzamt abführen.
Die Grunderwerbsteuer bei Erbschaft und Schenkung (Stufenmodell)
Bei Schenkung und Erbschaft handelt es sich um einen unentgeltlichen Erwerb. Hier gilt in Sachen Grunderwerbsteuer ein sogenanntes Stufenmodell. Dies bedeutet konkret:
- Bemessungsgrundlage: der sogenannte Grundstückswert
- Steuersatz: 0,5 % bis 3,5 % nach dem Stufentarif
Der Stufentarif für die Grunderwerbsteuer in Österreich gliedert sich wie folgt:
|
Grundstückswert |
Grunderwerbsteuer |
|
Für die ersten 250.000 Euro |
0,5 % |
|
Für die folgenden 150.000 Euro |
2,0 % |
|
Ab 400.000 Euro |
3,5 % |
Beispielfall: Eine Mutter schenkt ihrer Tochter ihr Haus, das einen Grundstückswert von 600.000 Euro hat. Werden also 250.000 Euro mit 0,5 % besteuert, die nächsten 150.000 Euro mit 2,0 % und die restlichen 200.000 Euro mit 3,5 %.
250.000 Euro x 0,005 + 150.000 Euro x 0,02 + 200.000 Euro x 0,035 = 11.250 Euro
Insgesamt fallen für die Tochter somit Steuern in der Höhe von 11.250 Euro an
INFOBOX: Ein kleiner Exkurs zum Thema Grundstückswert
|
Das Pauschalwertmodell: Bei diesem Berechnungsverfahren fließen Faktoren wie Grundfläche, Bodenwert, Lage, Grundrissfläche und Alter des Gebäudes ein. Der Immobilienpreisspiegel: Sie können auch die veröffentlichten Immobiliendurchschnittspreise der Statistik Austria mit einem Abschlag von 28,75 % zur Berechnung heranziehen. Nachweis des geringeren gemeinen Werts: Die dritte Möglichkeit der Wertermittlung individuelle sind Gutachten oder eine Bankenschätzung. |
Fälligkeit der Grunderwerbsteuer – wer und wann?
Wer muss die Grunderwerbsteuer bezahlen?
Grundsätzlich sind alle Personen, die am Erwerb eines Grundstücks oder einer Immobilie beteiligt sind, für die Zahlung der Grunderwerbsteuer verantwortlich. Dies gilt für Käufer und Verkäufer sowie Schenkender und Beschenkter gleichermaßen.
- In der Regel übernimmt aber der Käufer bzw. Beschenkte die Summe.
- Im Fall einer Erbschaft ist die erbende Person allein zuständig.
Wann ist die Grunderwerbsteuer zu bezahlen?
Sobald Sie Ihren Kaufvertrag bzw. Schenkungsvertrag abschließen, werden Sie gesetzlich steuerpflichtig. Spätestens zum 15. des übernächsten Monats müssen Sie den Erwerbsvorgang melden – also eine Abgabenerklärung dem Finanzamt übermitteln. In der Praxis übernimmt dies ein Rechtsanwalt oder Notar, der für Sie alle Fristen und Gebühren erkundet.
Grunderwerbsteuer-Bescheid: Im Anschluss erhalten Sie vom Finanzamt den sogenannten Grunderwerbsteuer-Bescheid. Nach dessen Zustellung haben Sie einen Monat Zeit, um die Steuer zu begleichen.
Unentgeltlichen Erwerb: Beim unentgeltlichen Erwerb – also beispielsweise Erbschaft, Schenkung oder Übergabe in der Familie – können Sie die Grunderwerbsteuer in Raten an das Finanzamt bezahlen. Maximal über 5 Jahre und mit Aufschlag.
Tipp: Bei einer Aufteilung der Steuerschuld auf 2 Jahre erhöht sich die Steuerschuld um vier %, für jedes weitere Jahr kommen zusätzliche zwei % dazu. Wenn Sie beispielsweise eine Steuerschuld von 25.000 Euro auf vier Jahre aufteilen, dann erhöht sich diese um acht % auf satte 27.000 Euro.
Sonderegeln bei Grunderwerbsteuer – Verwandte, Landwirtschaft, teilentgeltlicher Erwerb
Grunderwerbsteuer zwischen Verwandten
Sonderregelungen im Sachen Grunderwerbsteuer gibt es bei Grundstücksübertragungen unter Verwandten. Diese werden nach den Vorgaben des unentgeltlichen Erwerbs behandelt – auch im Falle einer Kaufpreiszahlung bezahlt wird. Konkret bedeutet dies:
- Bemessungsgrundlage: ist der Grundstückswert
- Steuersatz: nach dem Stufentarif von 0,5 bis 3,5 %
Familienangehörige sind demnach steuerlich begünstigt, wenn sie sich gegenseitig ein Grundstück verkaufen. Seit 2016 zählen zum begünstigten Familienkreis folgende Personen:
- Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner
- Lebensgefährten mit gleichem Wohnsitz
- Eltern
- Kinder, Stief- und Adoptivkinder
- Enkelkinder
- Geschwister
- Nichten und Neffen
- Verschwägerte in gerader Linie
Beispielfall: Rentnerin S. verkauft nach dem Tod ihres Mannes dem Enkelkind das Einfamilienhaus um 550.000 Euro. Steuerlich gilt dies als unentgeltlicher Erwerb, da es sich um einen Erwerb innerhalb der Familie handelt – obwohl ein Kaufpreis bezahlt wurde. Der ermittelte Grundstückswert beträgt 425.000 Euro. Steuerlich wird der Stufentarif auf den Grundstückswert angewendet, daher muss die Enkelin 16.000 Euro an Steuern ans Finanzamt zahlen:
250.000 Euro x 0,005 + 175.000 Euro x 0,02 = 16.000 Euro
Grunderwerbsteuer in der Landwirtschaft
Auch für die Übergabe von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken sieht der Gesetzgeber in Österreich eine geringere Besteuerung vor. Wird Grund im Familienverband verschenkt, verkauft oder vererbt, gilt Folgendes:
- Bemessungsgrundlage: der einfache Einheitswert
- Steuersatz: 2,0 %
Wichtig: Der Einheitswert wird vom Finanzamt nach einem standardisierten Verfahren ermittelt und liegt in der Regel weit unter dem Verkehrswert – also dem Preis, zu dem das Grundstück am Markt verkauft werden könnte – oder dem eigentlichen Grundstückswert. Somit fallen, vergleichsweise geringere Steuern an.
Teilentgeltlicher Erwerb
Unter teilentgeltlichen Erwerb versteht der Gesetzgeber den Verkauf eines Grundstücks außerhalb des Familienverbandes zu einem sehr geringen Preis. Hierzu darf der Kaufpreis in aller Regel nur zwischen 30 % und 70 % vom realen Grundstückswert ausmachen.
In diesem Fall sieht die steuerliche Behandlung so aus:
- Bemessungsgrundlage: ist der Grundstückswert
- Steuersatz: 3,5 % für den entgeltlichen Teil (Kaufpreis) und Stufentarif für den Restwert
Befreiung von der Grunderwerbsteuer – was ist möglich?
In einigen wenigen Fällen muss in Österreich keine Grunderwerbsteuer bezahlt werden. Zu den gängigsten Fällen zählen:
- Die Bemessungsgrundlage beträgt weniger als 1.100 Euro.
- Erwerb vom Ehepartner bzw. eingetragenen Partner bis zu einer Größe von 150 m².
- Erbschaft vom Ehepartner bzw. eingetragenen Partner bis zu einer Größe von 150 m².
- Übertragung von Betriebsgrundvermögen bis zu 900.000 Euro.
- Schenkung bzw. Erbschaft von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken im Familienkreis bis zu 365.000 Euro.
- Die Schenkung oder Erbschaft geht an eine gemeinnützige Vereinigung.
Grunderwerbsteuer als Sonderausgabe – was ist absetzbar?
Sie können die Grunderwerbsteuer als Sonderausgaben von der Steuer absetzen, wenn Sie
- ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung bauen und hierfür Steuer gezahlt haben
- und der Vertrag für die Errichtung vor dem 1. Jänner 2016 geschlossen wurde.
In diesem Fall können Sie die Errichtungskosten steuerlich geltend machen: also sämtliche Grundstückkosten inklusive der Grunderwerbsteuer. Beim Kauf einer Mietwohnung können Sie leider nichts absetzen. Gleiches gilt, wenn der Errichtungsvertrag nach dem 1. Jänner 2016 abgeschlossen wurde.
Fazit zum Thema Grunderwerbsteuer in Österreich
Die Grunderwerbsteuer in Österreich beträgt bei entgeltlichen Erwerben grundsätzlich 3,5 Prozent des Kaufpreises bzw. des Grundstückswerts (Mindestbemessungsgrundlage). Unentgeltliche Erwerbsvorgänge im Familienkreis werden steuerlich begünstigt: Zum einen wird der niedrigere Grundstückswert als Bemessungsgrundlage herangezogen, zum anderen kommt ein steuerliches Stufenmodell zur Anwendung. Hier beginnt der Steuersatz bei 0,5 Prozent für die ersten 250.000 Euro, die nächsten 150.000 Euro werden mit zwei Prozent besteuert, für alle Beträge darüber hinaus werden 3,5 Prozent fällig. Geringere Grunderwerbsteuern gelten weiters für land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke sowie für den teilentgeltlicher Erwerb mit deutlich geringeren Grundstückspreisen.
Zudem verzichtet der Fiskus in einigen klar definierten Fällen gänzlich auf die Zahlung der Grunderwerbsteuer. In Sachen steuerlicher Absetzbarkeit gibt es allerdings nur eine Möglichkeit – den angesprochenen Erwerb von Eigenheim oder Eigentumswohnung mit Errichtungsvertrag vor dem 1. Jänner 2016.
Schließlich gilt: Wenn Sie ein Haus, ein Grundstück oder eine Eigentumswohnung erwerben, sollten Sie keinesfalls die Nebenkosten vergessen. Hierfür sind nochmals rund zehn Prozent vom Kaufpreis einzukalkulieren.
Video: Grundlagen der Grunderwerbsteuer
Quelle: Steuern mit Kopf / YouTube
FAQ
Wie viel Grunderwerbsteuer und Notarkosten fallen in Österreich an?
In jedem Fall müssen Sie beim Kauf einer Immobilie die Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5 Prozent des Kaufpreises zahlen. Notar- und Grundbuchkosten sind je nach Bundesland unterschiedlichen und betragen im Durchschnitt um bis 6,5 Prozent
Wie berechnet man die Grunderwerbsteuer?
Die Grunderwerbsteuer berechnet sich aus dem Kaufpreis des notariellen Kaufvertrages und bezieht sich somit auf den aktuellen Wert der Immobilie. Die Höhe der Grunderwerbsteuer variiert zwischen 0,5 und 3,5 Prozent – je nachdem ob Schenkung, Erbschaft oder Kauf.
Wie lässt sich die Grunderwerbsteuer verringern?
Käufer von Bestandsimmobilien können die Grunderwerbsteuer reduzieren. Der Trick ist, bewegliche und unbewegliche Bestandteile einer Immobilie im Kaufvertrag zu trennen. Das Finanzamt ziehen dann den Wert der beweglichen Gegenstände vom Kaufpreis der Immobilie ab.
Was passiert, wenn der Käufer die Grunderwerbsteuer nicht zahlen kann?
Zahlt der Käufer die Grunderwerbsteuer nicht, ist im Außenverhältnis gegenüber dem Finanzamt auch der Verkäufer zur Zahlung der Grunderwerbsteuer verpflichtet. Bei Rückabwicklung des Vertrages wird der Grunderwerbsteuerbescheid aufgehoben. Dann entfällt auch die Haftung des Verkäufers.
Sollte man in Sachen Grunderwerbsteuer einen Anwalt oder Notar hinzuziehen?
Rechtsanwälte oder ein Notar können das Aufstellen der Rechnung übernehmen. Dies empfiehlt sich besonders bei sehr wertvollen Objekten. Die ausstehende Summe muss nicht zwingend vom neuen Eigentümer bezahlt werden. Der Staat lässt den Vertragsparteien freie Wahl. Entscheidend ist nur, dass die Summe beglichen wird.