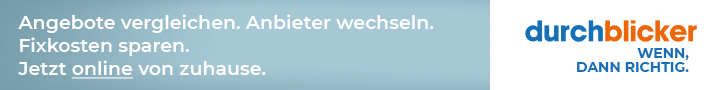Warum ist eine Bauherrenhaftpflichtversicherung sinnvoll?
Wer ein Haus baut oder bauen lässt, der braucht auch entsprechende Versicherungen. Diese sind beispielsweise erforderlich, um sich gegen Haftpflichtansprüche Dritter zu schützen. Die gängigste Versicherung ist die sogenannte Bauherrenhaftpflichtversicherung, welche häufig in Anspruch genommen wird, wenn es auf einer Baustelle zu Unfällen oder Verletzungen kommt.
Inhaltsverzeichnis
| Wer gilt als Bauherr? |
| Schäden & Haftung |
| Abdeckung |
| Kosten |
| Wie finde ich eine gute Versicherung? |
| Weitere Versicherungen |
| Fazit, Video & FAQ |
Bausparen, Versicherungen und mehr können Sie bei unserem Partner Durchblicker vergleichen:
Hintergrundwissen zum Thema Bauherrenhaftpflicht
Wer eine Baustelle betreibt, muss dafür sorgen, dass diese sicher ist. Insbesondere müssen gefährliche Bereiche abgesichert werden – gegen das Betreten durch Außenstehende und natürlich auch gegen den Zutritt von Kindern. In der Praxis kommt es auf Baustellen dennoch sehr schnell zu Unfällen und zu Verletzungen. Neben geeigneten Sicherungsmaßnahmen ist daher eine ausreichend hohe Bauherrenhaftpflichtversicherung unbedingt nötig.
Optimal versichert: Wer gilt eigentlich als Bauherr?
Als Bauherr gelten alle Personen, die durch das Veranlassen eines Bauvorhabens eine Gefahrenquelle für Arbeiter oder Besucher schaffen. Dabei kann es sich um eine natürliche Person oder juristische Personen handeln. Viele Häuslebauer unterliegen dem Irrtum, als Bauherr kein eigenes Haftungsrisiko zu tragen, weil sie den Bau in der Regel nicht selbst durchführen, sondern sachverständige Personen und Firmen damit beauftragen.
Allerdings wird der Bauherr nicht von seinen Sorgfaltspflichten befreit. Bei deren Verletzung kann aus einem Schaden rasch ein Haftpflichtschaden mit weitreichenden Folgen werden. Zu den allgemeinen Haftungsfällen gehören die Verkehrssicherungspflicht, die Auswahlpflicht und die Überwachungspflicht.
Welche Schäden können passieren und wo haftet der Bauherr?
Grundsätzlich trägt der Bauherr die Verantwortung, dass die Baustelle ordentlich abgesichert wird. Diese Verantwortung wird in der Praxis oft an einen Bauunternehmer bzw. einen Bauleiter übertragen. Das bedeutet jedoch nicht, dass auch die Haftung abgetreten werden kann – denn Bauleiter oder Bauunternehmer müssen durch den Bauherrn beobachtet und überwacht werden.
Personen- und Sachschäden: Grundsätzlich gibt es eine Reihe von möglichen Gefahren und Unfällen, bei denen die Bauherrenhaftpflichtversicherung von Vorteil ist. In der Praxis kommt es oft zu Sachschäden, aber auch Personenschäden können nicht ausgeschlossen werden. So verletzen sich Handwerker oder Lieferanten regelmäßig bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten, Passanten sowie Nachbarn können sich beim Besuch der Baustelle verletzen, oder der Bauherr selbst verletzt beim Erkunden des Baufortschritts. Sachschäden hingegen können am Bau selbst, aber auch auf angrenzenden Nachbargrundstücken und Straße entstehen.
Zwei Beispielfälle: Typische Beispiele für einen Unfall auf der Baustelle ist ein Arbeiter, der von einem Gerüst stürzt oder jemand, der in eine Grube fällt, weil diese nicht ordentlich abgesichert wird.
Sicherheitsvorschriften: Für gewöhnlich arbeiten auf einer Baustelle mehrere Gewerbe bzw. entsprechend beauftragte Unternehmer gleichzeitig. Auch hier hat der Bauherr darauf zu achten, dass alle nach den entsprechend gesetzlichen Vorschriften handeln – oder er muss eine Person finden, die sich insbesondere um folgendes kümmert:
- die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
- das Einhalten der Gefahrengutvorschriften
- das Einhalten der Baustellensicherheit
Wer also weiß, wie groß Verantwortung und Haftung als Bauherr sind, wird sich rasch über notwendige Versicherungen informieren. In der Regel ist zwar bei Privathaftpflichtversicherungen ein entsprechendes Bauherrenrisiko inkludiert, die enthaltenen Deckungssummen sind allerdings für mögliche Unfälle oder höhere Schäden viel zu gering. Nur eine Bauherrenhaftpflichtversicherung kann entsprechende Schadenersatzzahlungen abwehren.
Welche Schäden deckt eine Bauherrenhaftpflichtversicherung?
Im Idealfall sichert eine Bauherrenhaftpflichtversicherung Schäden an Personen, an Sachgegenständen sowie sogenannte Vermögensschäden ab. Die Versicherung übernimmt alle Zahlungen in diesen Bereichen, sofern der Bauherr dazu verpflichtet ist, Schadenersatz zu leisten. Wird der Bauherr nicht in Haftung genommen oder ein Anspruch zu Unrecht geltend gemacht, währt die Versicherung unberechtigte Ansprüche ab – notfalls auch vor Gericht.
Allmählichkeitsschäden: Weiters ist die Bauherrenhaftpflicht für sogenannte Allmählichkeitsschäden zuständig. Hierbei handelt es sich um Schäden, die meist erst nach einer gewissen Zeit sichtbar sind, aber im Zusammenhang zum Bauvorhaben nachgewiesen werden.
Hierzu zählen insbesondere:
- Wetterbedingte Schäden am Rohbau
- Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosionen
- Schäden durch Vandalismus und Diebstahl (Baugeräte, Materialien, Inventar)
- Schäden durch Eigenschaften des Baugrundes (Aufschwimmen des Rohbaus)
- Schäden durch nicht ordnungsgemäß gesicherte Baustelle (Kind verletzt sich beim Spielen)
- Schäden durch unzureichend / nicht gesichertes Baumaterial (Unfälle auf angrenzenden Straßen oder Nachbargrundstücken)
- Schäden nach dem Aushub der Baugrube (Gebäude der Nachbarn)
Wichtig: Der Versicherungsschutz einer Bauherrenhaftpflichtversicherung umfasst Schadensereignisse, die während der gesamten Dauer der Bauzeit eintreten und endet in der Regel mit der Bauendabnahme – oder mit Ende einer vereinbarten Laufzeit. Wird das Bauvorhaben in mehrere Etappen durchgeführt, besteht ein Versicherungsschutz auch in der Zeit zwischen den einzelnen Bauabschnitten. Allerdings endet dieser spätestens nach drei Jahren. Sollte also das Bauprojekt nicht rechtzeitig abgeschlossen sein, gilt es den Vertrag vorzeitig zu verlängern.
Tipp: Wenn Sie im Internet die Tarife und Versicherungen vergleichen, werden feststellen, dass es hier deutliche Unterschiede gibt. Daher ist es sinnvoll, sich zunächst über die entsprechenden Leistungen zu informieren und darauf zu achten, was alles abgesichert werden kann.
Bauherrenhaftpflicht: Welche Deckungssumme ist sinnvoll und wie wird sie berechnet?
Entscheidend in Sachen Bauherrenhaftpflicht ist die Deckungssumme. Deren Höhe kann individuell an das Bauvorhaben angepasst werden – als Bauherr sollten Sie hier keinesfalls am falschen Ende sparen.
Individuelle Deckungssumme ermitteln: Generell gilt – je höher eine Deckungssumme ist, umso höher sind die potenziellen Schäden, die abgesichert werden. In der Praxis sind hier – je nach Versicherung – Summen von zehn Millionen und mehr Euro je Versicherungsfall abgedeckt.
Wie hoch die Deckungssumme genau ausfallen muss, sollte im Detail vorab geklärt werden. Hierzu ist es notwendig, die Summe des gesamten Bauvorhabens sowie dessen voraussichtliche Dauer möglichst genau zu beziffern. Wer diese kennt, muss durchschnittlich mit einem Beitragssatz von etwa einem Prozent rechnen und kann daraus in etwa netto den Beitrag der Versicherungsprämie ermitteln.
Tipp: Lassen Sie sich hierzu unbedingt vor Beginn der Bautätigkeit von einem Fachmann beraten, um ein individuelles Angebot zu erstellen. Als Laie sind mögliche Risiken am Bau und die dafür nötigen Deckungssummen nur schwer einzuschätzen.
Was kostet eine Bauherrenhaftpflichtversicherung im Detail?
Die Prämie zur Bauherrenhaftpflicht berechnet sich aus der gewünschten Versicherungssumme und der Bauzeit des Gebäudes. In der Regel belaufen sich die Kosten auf ein Promille Bausumme. Planen Sie beispielsweise ein 400.000 Euro teures Einfamilienhaus, müssen Sie um die 400 Euro Gesamtprämie für die Versicherung zahlen. Hierbei wird generell von einer Bauzeit von bis zu drei Jahren bei den meisten Häusern ausgegangen.
Der durchschnittliche jährliche Beitrag in diesem Beispiel für ein Haus von 400.000 Euro wird von Versicherern mit 400 x 0,40 Euro angesetzt – somit kommen Bauherrn auf eine Prämie in Höhe von 160 Euro. Der Mindestbeitrag für die Bauherrenhaftpflichtversicherung beläuft sich bei vielen Versicherungen auf rund 100 Euro. Unter dem Strich sind die Kosten für eine Bauherrenhaftpflicht also recht niedrig, weshalb es in jedem Fall zu empfehlen ist, die entsprechende Polizze abzuschließen.
Mögliche Zusatzleistungen: Sollten Schäden durch Bauherren selbst oder Freunde und Nachbarn entstehen, die auf der Baustelle ohne erforderliche Ausrüstung und Schutzausrüstung helfen, so ist es möglich, entsprechende Leistungen ebenfalls zu versichern. Oftmals wird hierfür ein geringer Zuschlag von 25 bis 50 Euro für die Versicherungsprämie fällig.
Wie finde ich eine gute Bauherrenhaftpflichtversicherung?
Wer sich online in Sachen Bauherrenhaftpflichtversicherung informiert wird feststellen, dass es jede Menge Optionen gibt, wie man sich eine passende Polizze zusammenstellen kann. Das dauert in der Regel nur wenige Minuten und hat jede Menge Vorteile – sowohl in Bezug auf die Kosten als auch den enthaltenen Leistungen.
Um mittels kostenloser Online-Rechner Angebote verschiedener Versicherungen berechnen und vergleichen zu können, sind allerdings einige Angaben nötig, beispielsweise:
- Art des Bauvorhabens (Neubau, Sanierung)
- Preis für das Bauvorhaben (gesamte geschätzte Bausumme)
- Dauer des Bauvorhabens (Komplettbau, Bauabschnitte)
- Gebäudetyp (Einfamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus)
- Exakte Lage des Bauvorhabens (Bundesland, PLZ)
- Ausführung des Bauvorhabens (Unternehmen, Privat- und Freundschaftsdienste)
Bausparen, Versicherungen und mehr können Sie bei unserem Partner Durchblicker vergleichen:
Weitere Versicherungen neben der Bauherrenhaftpflicht
Bauwesensversicherung: Hierbei handelt es sich um eine Kaskoversicherung für Ihren Rohbau. Im Gegensatz zur Bauherrenhaftpflichtversicherung deckt die Bauwesenversicherung Schäden am Rohbau ab, sollte dieser durch Feuer, Sturm, anderen Elementargefahren oder Vandalismus beschädigt werden. Weiters lassen sich hier Gefahren wie Glasbruch oder Erdbeben einschließen.
Rohbauversicherung: Als Kombiversicherung umfasst die sogenannte Rohbauversicherung sowohl die Bauwesenversicherung als auch die Bauherrenhaftpflicht. Diese gibt es bereits zu sehr günstigen Prämien, die Versicherungsdauer umfasst üblicher Weise drei Jahre. Nach Abschluss der Bauarbeiten enden alle diese Versicherungen automatisch.
Bauherrenhaftpflicht – kurzes Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Bauherren tragen weit mehr Verantwortung, als oft vermutet wird. Schadensfälle am Bau können jederzeit eintreten und sind für Laien nur schwer einzuschätzen. Hinzu kommt ein immenses Kostenrisiko durch Personenschäden, Sachschäden oder Allmählichkeitsschäden – wer hier nicht ausreichend versichert ist, gefährdet rasch sein gesamtes Bauvorhaben und damit das investierte Kapital. Sparen Sie also besser nicht an der falschen Stelle und sorgen Sie mit einer individuell gestalteten Bauherrenhaftpflichtpolizze vor.
Video: Bauherrenhaftpflichtversicherung einfach erklärt
Quelle: Immobilien mit Kopf / YouTube
FAQ
Wann muss man eine Bauherrenhaftpflicht abschließen?
Eine Bauherrenhaftpflicht sollten Sie noch vor Baubeginn abschließen, denn sobald der Architekt oder die Baufirma die Planung aufnehmen, haften Sie für Schäden. Die Bauherrenhaftpflicht endet mit der Beendigung der Baumaßnahmen. Der Versicherungsbeitrag für die Bauherrenhaftpflicht wird als Einmalzahlung fällig.
Wie viel kostet die Bauherrenhaftpflichtversicherung?
Die Kosten für die Bauherrenhaftpflicht belaufen sich in der Regel auf ein Promille, also ein Tausendstel der Bausumme. Wenn Sie beispielsweise ein 250.000 Euro teures Einfamilienhaus planen, müssen Sie zwischen 200 und 300 Euro an Versicherungssumme zahlen.
Was deckt die Bauherrenhaftpflichtversicherung ab?
Die Bauherrenhaftpflicht deckt alle Haftpflichtrisiken des Versicherungsnehmers als Bauherr und / oder Besitzer des zu bebauenden Grundstücks ab. Grundsätzlich werden Schäden ersetzt, die Dritten auf der Baustelle oder aufgrund ihres Vorhandenseins zugefügt werden – Sach- und Personenschäden sowie Allmählichkeitsschäden.
Welche Summe bei Bauherrenhaftpflicht?
Die Kosten der Bauherrenhaftpflicht richten sich nach der Höhe der Bau- und der Versicherungssumme. Empfehlenswert ist eine Versicherungssumme von mindestens drei bis fünf Millionen Euro für Personen- und Sachschäden, wobei die meisten Versicherer diesen Betrag ohnehin als Untergrenze ansetzen.
Wann zahlt Bauherrenhaftpflicht nicht?
Die Bauherrenhaftpflichtversicherung zahlt grundsätzlich nicht, wenn ein Arbeiter einen Unfall auf der Baustelle hat. Denn das ist ein Arbeitsunfall und ein Fall für die gesetzliche Unfallversicherung. Die Bauherrenhaftpflicht ist aber trotzdem hilfreich: Denn sie wehrt den Schadensersatzanspruch des Arbeiters für Sie als Bauherren ab.